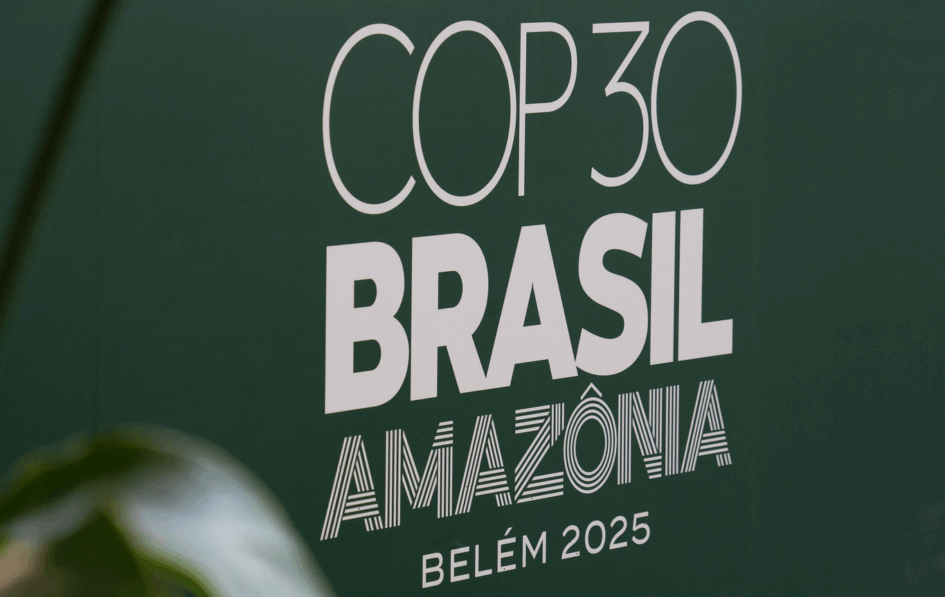Die UN-Klimakonferenz COP30 in Belém bringt die internationalen Klimaverhandlungen zurück in eine Demokratie, in ein Land des Globalen Südens und in die für das globale Klimasystem enorm wichtige Amazonas-Region. Erstmals seit Jahren wird es mit dem von der Lateinamerikanischen Zivilgesellschaft organisierten und von über 10.000 Personen besuchten People’s Summit einen kraftvollen, inspirierenden und mobilisierenden Raum für die globale Klimabewegung geben, welche weit über die COP30 hinaus ausstrahlen wird.
Von der Österreichischen Bundesregierung fordert die Allianz für Klimagerechtigkeit verstärkten Einsatz für die ambitionierte und gerechte Weiterentwicklung des internationalen Klimaregimes.
Anliegen der Allianz für Klimagerechtigkeit zu den Verhandlungen auf der COP30
Umfassender Klimaschutz
- Auf Basis des nationalen Klimaneutralitätsziels für 2040 aus dem Regierungsprogramm soll sich die österreichische Bundesregierung für ein starkes EU NDC auf Basis eines EU 2040-Zieles von mindestens 90 % Treibhausgas-Reduktion einsetzen, welches weiterhin durch Klimaschutz-maßnahmen innerhalb der EU erreicht werden soll und nicht durch den Zukauf von Zertifikaten.
- Da aller Voraussicht nach die kollektiven nationalen Klimaziele (NDCs) noch nicht ausreichen um das 1,5°C Ziel einzuhalten, müssen alle Staaten und Staatengruppen ihre NDCs bis zur COP31 in Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens bringen und eine konsequente Umsetzung dieser sicherstellen.
- Die Staaten müssen sich bei der kommenden Klimakonferenz für einen klaren Ausstieg aus fossiler Energie aussprechen. Die Verdreifachung erneuerbarer Energie, die Verdoppelung der Energieeffizienz und der Ausstieg aus Subventionen für fossile Energie bis 2030 sind beschlossen und müssen in den nationalen Zielsetzungen berücksichtigt werden.
- Initiativen, die zu einer nachhaltigen Verbesserung von Umsetzungsprozessen, Transparenz, Rechenschaftspflicht, Entscheidungsfindung, Bürgerbeteiligung und zivilgesellschaftlichem Handlungsspielraum bei den Klimakonferenzen und anderen Veranstaltungen des UNFCCC führen, sollen von Österreich unterstützt werden (beispielsweise ein Rat unter der UN Generalversammlung mit klarem Mandat und Zweck, klar definierten Funktionen und robusten Mechanismen, der zwar unabhängig vom UNFCCC, aber dessen Arbeit ergänzend ist).
Anpassung sowie Schäden und Verluste
- Das Rahmenwerk des Global Goal on Adaptation muss Indikatoren für Means of Implementation (MOI) enthalten, die den Zugang, die Qualität und die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen messen, einschließlich der Bereitstellung von Mitteln gemäß des Pariser Abkommens. Hierbei muss die Rolle von Gemeinden und der Finanzierungszugang für die lokale Ebene berücksichtigt sein. Ebenso muss Anpassungsfinanzierung in konfliktbetroffenen Ländern priorisiert werden, da diese am stärksten betroffen sind, aber derzeit nur einen kleinen Anteil an Finanzierung erhalten.[1] Die Baku Adaptation Roadmap (BAR) muss operationalisiert werden, um eine wirksame Umsetzung der Anpassungsbemühungen sicherzustellen.
- Das UAE Framework for Global Climate Resilience der COP28 setzt im Gesundheitsbereich das Ziel einer signifikanten Reduktion von klimabedingter Morbidität und Mortalität, besonders für vulnerable Gemeinden. Dafür muss zukünftig v.a. der Umgang mit Hitzewellen gesamtstaatlich und multi-sektoral in nationalen Klimaplänen (NAPs und NDCs) verankert werden, Investitionen auf Gemeindeebene in Anpassung und Risikominderung getätigt werden und präventive und antizipierende Ansätze im Katastrophenschutz umgesetzt werden.
- Der Fund for Responding to Loss and Damage muss entsprechend der wachsenden Bedürfnisse finanziert werden -u.a. durch innovative Finanzierungsquellen und planbare öffentliche Zuschüsse durch die Industrieländer. Der Fonds soll von den Grundsätzen der Gerechtigkeit, Inklusivität, Zugänglichkeit und Nichtdiskriminierung geleitet sein, zeitnah und vorhersehbar agieren können und für die lokale Ebene – insbesondere für von Frauen geführte Organisationen und indigene Gruppen – zugänglich sein. Ebenso soll das Santiago-Network mit ausreichend Ressourcen ausgestattet werden.
Internationale Klimafinanzierung
- Österreich soll auf der COP30 einen adäquaten Beitrag bis 2030 zur Erreichung des 300-Milliarden-USD-Ziels des NCQG ankündigen. Dieser Beitrag soll zu großen Teilen aus Zuschüssen bestehen und auch steigende Beiträge zur Auffüllung des Anpassungsfonds enthalten, um die zugesagte Verdreifachung der Finanzierung durch die UNFCCC Finanzmechanismen bis 2030 zu erreichen. Dabei sollte das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs (ICJ Advisory Opinion No. 187) als Richtschnur dienen, da es unter der UNFCCC und dem Pariser Abkommen verbindliche Verpflichtungen von Industriestaaten zur finanziellen Unterstützung vulnerabler Staaten zur Erreichung des 1,5°C Ziels bestätigt.
- Österreich soll innerhalb der EU darauf drängen, einen Aktionsplan zur Umsetzung des NCQG und der „Baku to Belém Roadmap to 1.3T“ zu unterstützen. Dabei soll die Wichtigkeit von öffentlichen Zuschüssen anerkannt und ein realistischer Ansatz zu Mobilisierung und der Rolle des Privatsektors gewählt werden. Zudem soll die EU eine Entscheidung zur Verdreifachung der zuschussbasierten Anpassungsfinanzierung bis 2030 unterstützen und konstruktiv zur Verortung der Rechenschaftspflicht zu Art 9.1 des Pariser Abkommens in der CMA Agenda beitragen.
- Österreich soll gemeinsam mit der EU auf eine Entscheidung zu einem (weiterführenden) Prozess zum Art. 2.1c des Pariser Abkommens und Prinzipien zur dessen gerechter Erreichung hinwirken. Ziel des Prozesses muss ein Ende von allen fossilen Subventionen aus nationalen Budgets und eine marktbeeinflussende Regulierung privater Finanzierungen sein (d.h. Finanzierungsverbot für fossile Projekte und deren Entwickler*innen und konkret eine Halbierung finanzierter Emissionen des privaten Finanzmarktes bis 2030). Beide Ziele werden von der ICJ Advisory Opinion gestützt, welche fossile Subventionen eines Staates als möglichen „internationally wrongful act which is attributable to that State“ beschreibt und eine Sorgfaltspflicht der Staaten gegenüber den Klimaschäden des Privatsektors feststellt.[2]
- Österreich soll sich konstruktiv an den Verhandlungen für ein starkes UN-Steuerrahmenabkommen (UN Framework Convention on International Tax Cooperation) beteiligen und dieses unterstützen. Dabei soll sich Österreich entlang des Verhandlungsmandates für eine klare Unterstützung von Klimazielen durch die Steuerkooperation und damit für Steuern als stabile Quelle für Klimafinanzierung einsetzen.
Partizipation, Disability, Gender und Konfliktsensibilität
- Menschen mit Behinderungen (16% der Bevölkerung weltweit) sind von den Auswirkungen der Klimaerhitzung überproportional betroffen. Ihre Rechte und Bedürfnisse werden aber in Klimapolitiken, zum Beispiel in Anpassungsmaßnahmen, nicht ausreichend berücksichtigt. Daher sollte Österreich die Anerkennung einer offiziellen UNFCCC Constituency für Menschen mit Behinderungen[3] im zwischenstaatlichen Verhandlungsprozess unterstützen und auf eine Position der EU dazu hinwirken.
- In den letzten Jahren wurde die Beteiligung der Zivilgesellschaft bei der COP immer weiter eingeschränkt – eine breite Beteiligung ist jedoch notwendig, um die Aushandlungsprozesse inklusiv zu gestalten, kritisch zu beobachten und so auch die Stimmen von besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen einzubringen. Die Österreichische Bundesregierung soll sich im Rahmen der Verhandlungen für die Einhaltung der Menschenrechte vor allem in den COP-Gastgeberländern (z.B. im Host Country Agreement) aussprechen.
- Sicherstellung der uneingeschränkten, gleichberechtigten, sinnvollen und sicheren Beteiligung von Frauen, Mädchen, Menschen mit Behinderungen, indigenen Völkern, Jugendlichen und anderen marginalisierten Gruppen innerhalb des UNFCCC sowie bei nationalen Planungs- und Umsetzungsprozessen. Ihre Führungsrolle ist für wirksame Klimamaßnahmen von entscheidender Bedeutung und sollte in die Planung, Umsetzung und das Monitoring einbezogen werden, um Inklusivität und vielfältige Perspektiven zu fördern.
- Der aktuelle Entwurf des UNFCCC Gender Action Plans (GAP) enthält wichtige Elemente, die beibehalten und weiter gestärkt werden sollten. Österreich muss sich im Rahmen der EU dafür einsetzen, dass etablierte menschenrechtliche Standards wie die Verwendung geschlechtergerechter und inklusiver Sprache gegen Rückschritte verteidigt werden. Darüber hinaus wird der Erfolg des GAP von einer kohärenten und wirkungsorientierten Umsetzung sowie einer angemessenen und vorhersehbaren Finanzierung abhängen.
- Konfliktsensibilität muss in alle, während der COP30 beschlossenen Maßnahmen, sowie in die Formulierung der Indikatoren für das globale Anpassungsziel (GGA) miteinfließen, damit diese keine neuen Konflikte auslösen, sondern Katalysator für Frieden werden. Weiters erhält die COP30 im Gegensatz zu vorherigen Konferenzen keinen eigenen Tag zum Thema Frieden und Sicherheit. Deswegen soll die österreichische Delegation friedensbezogene Aspekte während der COP einbringen.
Allianz für Klimagerechtigkeit, im Oktober 2025
[1] World Bank (2024): Closing The Gap. Trends in Adaptation Finance for Fragile and Conflict-affected Settings und SIPRI (2024): Unveiling Challenges and Gaps in Climate Finance in Conflict Areas
[2] ICJ (2025): Obligations of States in respect of Climate Change
[3] IDDC (2024): Global disability movement demands seat at the “COP table”